Türkische Gruppe. Türkische Sprachgruppe: Völker, Klassifikation, Verbreitung und interessante Fakten Türkische Sprachfamilie der Völker
TÜRKISCHE SPRACHEN, d. h. das System der türkischen (türkisch-tatarischen oder türkisch-tatarischen) Sprachen, nehmen ein sehr großes Gebiet in der UdSSR (von Jakutien bis zur Krim und zum Kaukasus) und ein viel kleineres Gebiet im Ausland (die Sprachen des Anatolien-Balkans) ein Türken, Gagausen und ... ... Literarische Enzyklopädie
TÜRKISCHE SPRACHEN- eine Gruppe eng verwandter Sprachen. Vermutlich ist es Teil der hypothetischen altaischen Makrosprachenfamilie. Es ist in westliche (westliche Xiongnu) und östliche (östliche Xiongnu) Zweige unterteilt. Der westliche Zweig umfasst: Bulgarische Gruppe Bulgar... ... Großes enzyklopädisches Wörterbuch
TÜRKISCHE SPRACHEN- ODER TURANISCH ist die allgemeine Bezeichnung für die Sprachen verschiedener Nationalitäten des Nordens. Asien und Europa, die ursprüngliche Heimat der Katze. Altai; daher werden sie auch Altai genannt. Wörterbuch der Fremdwörter der russischen Sprache. Pawlenkow F., 1907 ... Wörterbuch der Fremdwörter der russischen Sprache
Türkische Sprachen- TÜRKISCHE SPRACHEN, siehe tatarische Sprache. Lermontov-Enzyklopädie / Akademie der Wissenschaften der UdSSR. In t rus. zündete. (Puschkin. Haus); Wissenschaftlich Hrsg. Rat des Verlagshauses Sov. Enzykl. ; CH. Hrsg. Manuilov V. A., Redaktion: Andronikov I. L., Bazanov V. G., Bushmin A. S., Vatsuro V. E., Zhdanov V ... Lermontov-Enzyklopädie
Türkische Sprachen- eine Gruppe eng verwandter Sprachen. Vermutlich zur hypothetischen Makrofamilie der altaischen Sprachen gehörend. Es ist in westliche (westliche Xiongnu) und östliche (östliche Xiongnu) Zweige unterteilt. Der westliche Zweig umfasst: Bulgarische Gruppe Bulgar (alt ... ... Enzyklopädisches Wörterbuch
Türkische Sprachen- (veraltete Namen: Türkisch-tatarische, türkische, türkisch-tatarische Sprachen) Sprachen zahlreicher Völker und Nationalitäten der UdSSR und der Türkei sowie eines Teils der Bevölkerung Irans, Afghanistans, der Mongolei, Chinas, Bulgariens, Rumäniens, Jugoslawien und... ... Große sowjetische Enzyklopädie
Türkische Sprachen- Eine umfangreiche Gruppe (Familie) von Sprachen, die in den Gebieten Russlands, der Ukraine, den Ländern Zentralasiens, Aserbaidschans, Irans, Afghanistans, der Mongolei, Chinas, der Türkei sowie Rumänien, Bulgarien, dem ehemaligen Jugoslawien und Albanien gesprochen werden . Gehört einer Altai-Familie.… … Handbuch der Etymologie und historischen Lexikologie
Türkische Sprachen- Turksprachen sind eine Sprachfamilie, die von zahlreichen Völkern und Nationalitäten der UdSSR, der Türkei, einem Teil der Bevölkerung Irans, Afghanistans, der Mongolei, Chinas, Rumäniens, Bulgariens, Jugoslawiens und Albaniens gesprochen wird. Die Frage nach der genetischen Verwandtschaft dieser Sprachen zum Altai... Linguistisches enzyklopädisches Wörterbuch
Türkische Sprachen- (Türkische Sprachfamilie). Sprachen, die eine Reihe von Gruppen bilden, darunter die Sprachen Türkisch, Aserbaidschanisch, Kasachisch, Kirgisisch, Turkmenisch, Usbekisch, Kara-Kalpak, Uigurisch, Tatarisch, Baschkirisch, Tschuwaschisch, Balkarisch, Karatschaiisch,... ... Wörterbuch sprachlicher Begriffe
Türkische Sprachen- (Türkische Sprachen), siehe Altai-Sprachen... Völker und Kulturen
Bücher
- Sprachen der Völker der UdSSR. In 5 Bänden (Set) ist das Sammelwerk SPRACHEN DER VÖLKER DER UDSSR dem 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution gewidmet. Diese Arbeit fasst die Hauptergebnisse der Studie zusammen (synchron)… Kategorie: Philologische Wissenschaften im Allgemeinen. Besondere Philologien Reihe: Sprachen der Völker der UdSSR. In 5 Bänden Herausgeber: Nauka, Kaufen Sie für 11.600 RUB
- Türkische Konvertierungen und Serialisierung. Syntax, Semantik, Grammatikalisierung, Pavel Valerievich Grashchenkov, Die Monographie ist Konverben in -p und ihrem Platz im grammatikalischen System türkischer Sprachen gewidmet. Es stellt sich die Frage nach der Art der Verbindung (koordinierend, unterordnend) zwischen Teilen komplexer Prädikationen mit... Kategorie: Linguistik und Linguistik Herausgeber: Sprachen der slawischen Kultur, Hersteller:
Etwa 90 % der Turkvölker der ehemaligen UdSSR gehören dem islamischen Glauben an. Die meisten von ihnen leben in Kasachstan und Zentralasien. Die übrigen muslimischen Türken leben in der Wolgaregion und im Kaukasus. Von den Turkvölkern waren nur die in Europa lebenden Gagausen und Tschuwaschen sowie die in Asien lebenden Jakuten und Tuwiner vom Islam nicht betroffen. Die Türken haben keine gemeinsamen körperlichen Merkmale und nur ihre Sprache verbindet sie.
Die Wolgatürken – Tataren, Tschuwaschen, Baschkiren – standen lange Zeit unter dem Einfluss slawischer Siedler, und ihre ethnischen Gebiete haben heute keine klaren Grenzen mehr. Die Turkmenen und Usbeken wurden von der persischen Kultur beeinflusst, und die Kirgisen standen lange Zeit unter dem Einfluss der Mongolen. Einige nomadische Turkvölker erlitten während der Zeit der Kollektivierung erhebliche Verluste, wodurch sie gewaltsam an das Land gebunden wurden.
In der Russischen Föderation bilden die Völker dieser Sprachgruppe den zweitgrößten „Block“. Alle türkischen Sprachen sind sehr nahe beieinander, obwohl sie normalerweise mehrere Zweige umfassen: Kipchak, Oguz, Bulgarisch, Karluk usw.
Tataren (5522 Tausend Menschen) konzentrieren sich hauptsächlich auf Tatarien (1765,4 Tausend Menschen), Baschkirien (1120,7 Tausend Menschen),
Udmurtien (110,5 Tausend Menschen), Mordwinien (47,3 Tausend Menschen), Tschuwaschien (35,7 Tausend Menschen), Mari-El (43,8 Tausend Menschen), leben aber verstreut in allen Regionen des europäischen Russlands sowie in Sibirien und im Fernen Osten. Die tatarische Bevölkerung ist in drei ethno-territoriale Hauptgruppen unterteilt: Wolga-Ural-, Sibirier- und Astrachan-Tataren. Die tatarische Literatursprache wurde auf der Grundlage der mittleren Sprache gebildet, jedoch unter spürbarer Beteiligung des westlichen Dialekts. Es gibt eine besondere Gruppe von Krimtataren (21,3 Tausend Menschen; in der Ukraine, hauptsächlich auf der Krim, etwa 270 Tausend Menschen), die eine besondere, krimtatarische Sprache sprechen.
Baschkiren (1345,3 Tausend Menschen) leben in Baschkirien sowie in den Regionen Tscheljabinsk, Orenburg, Perm, Swerdlowsk, Kurgan, Tjumen und in Zentralasien. Außerhalb Baschkiriens leben 40,4 % der baschkirischen Bevölkerung in der Russischen Föderation, und in Baschkirien selbst stellt dieses Titularvolk nach den Tataren und Russen die drittgrößte ethnische Gruppe dar.
Die Tschuwaschischen (1.773,6 Tausend Menschen) stellen sprachlich einen besonderen, bulgarischen Zweig der Turksprachen dar. In Tschuwaschien beträgt die Titularbevölkerung 907.000 Menschen, in Tataria 134,2.000 Menschen, in Baschkirien 118,6.000 Menschen und in der Region Samara 117,8
Tausend Menschen, in der Region Uljanowsk - 116,5 Tausend Menschen. Allerdings weist das tschuwaschische Volk derzeit einen relativ hohen Konsolidierungsgrad auf.
Die Kasachen (636.000 Menschen, die Gesamtzahl auf der Welt beträgt mehr als 9 Millionen Menschen) wurden in drei territoriale Nomadenverbände aufgeteilt: Semirechye - Senior Zhuz (Uly Zhuz), Zentralkasachstan - Middle Zhuz (Orta Zhuz), Westkasachstan - Younger Zhuz (kishi zhuz). Die Zhuz-Struktur der Kasachen ist bis heute erhalten geblieben.
Aserbaidschaner (in der Russischen Föderation 335,9 Tausend Menschen, in Aserbaidschan 5805 Tausend Menschen, im Iran etwa 10 Millionen Menschen, insgesamt etwa 17 Millionen Menschen auf der Welt) sprechen die Sprache des oghuzischen Zweigs der Turksprachen. Die aserbaidschanische Sprache wird in östliche, westliche, nördliche und südliche Dialektgruppen unterteilt. Die meisten Aserbaidschaner bekennen sich zum schiitischen Islam, nur im Norden Aserbaidschans ist der Sunnitismus verbreitet.
Die Gagausen (10,1 Tausend Menschen in der Russischen Föderation) leben in der Region Tjumen, im Gebiet Chabarowsk, Moskau, St. Petersburg; die Mehrheit der gagausischen Bevölkerung lebt in Moldawien (153,5 Tausend Menschen) und der Ukraine (31,9 Tausend Menschen); getrennte Gruppen - in Bulgarien, Rumänien, der Türkei, Kanada und Brasilien. Die gagausische Sprache gehört zum oguzischen Zweig der Turksprachen. 87,4 % der gagausischen Bevölkerung betrachten die gagausische Sprache als ihre Muttersprache. Das gagausische Volk ist seiner Religion nach orthodox.
Meschetische Türken (9,9 Tausend Menschen in der Russischen Föderation) leben auch in Usbekistan (106 Tausend Menschen), Kasachstan (49,6 Tausend Menschen), Kirgisistan (21,3 Tausend Menschen) und Aserbaidschan (17,7 Tausend Menschen). Die Gesamtzahl in der ehemaligen UdSSR beträgt 207,5 Tausend.
Die Leute sprechen Türkisch.
Chakass (78,5 Tausend Menschen) – die indigene Bevölkerung der Republik Chakassien (62,9 Tausend Menschen), lebt auch in Tuwa (2,3 Tausend Menschen) und der Region Krasnojarsk (5,2 Tausend Menschen).
Tuwiner (206,2 Tausend Menschen, davon 198,4 Tausend Menschen in Tuwa). Sie leben auch in der Mongolei (25.000 Menschen) und in China (3.000 Menschen). Die Gesamtzahl der Tuwiner beträgt 235.000 Menschen. Sie sind in westliche (Bergsteppenregionen im westlichen, zentralen und südlichen Tuwa) und östliche oder Tuvan-Todzha (Berg-Taiga-Teil im nordöstlichen und südöstlichen Tuwa) unterteilt.
Altaier (Eigenname Altai-Kizhi) sind die indigene Bevölkerung der Altai-Republik. In der Russischen Föderation leben 69,4 Tausend Menschen, davon 59,1 Tausend in der Republik Altai. Ihre Gesamtzahl beträgt 70,8 Tausend Menschen. Es gibt ethnografische Gruppen der nördlichen und südlichen Altaier. Die Altai-Sprache ist in nördliche (Tuba, Kumandin, Cheskan) und südliche (Altai-Kizhi, Telengit) Dialekte unterteilt. Die meisten Altai-Gläubigen sind Orthodoxe, es gibt Baptisten und andere. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Burchanismus, eine Form des Lamaismus mit Elementen des Schamanismus, verbreitete sich unter den südlichen Altaiern. Bei der Volkszählung von 1989 bezeichneten 89,3 % der Altaier ihre Sprache als ihre Muttersprache und 77,7 % gaben an, fließend Russisch zu sprechen.
Teleuten werden derzeit als eigenständiges Volk identifiziert. Sie sprechen einen der südlichen Dialekte der Altai-Sprache. Ihre Zahl beträgt 3.000 Menschen, und die Mehrheit (etwa 2,5.000 Menschen) lebt in ländlichen Gebieten und Städten der Region Kemerowo. Der Großteil der Teleut-Gläubigen ist orthodox, aber auch traditionelle religiöse Überzeugungen sind unter ihnen verbreitet.
Das Volk der Tschulym (Tschulym-Türken) lebt in der Region Tomsk und im Krasnojarsker Gebiet im Einzugsgebiet des Flusses. Chulym und seine Nebenflüsse Yaya und Kii. Anzahl der Personen - 0,75 Tausend Menschen. Die Chulym-Gläubigen sind orthodoxe Christen.
Usbeken (126,9 Tausend Menschen) leben in der Diaspora in Moskau und der Region Moskau, in St. Petersburg und in den Regionen Sibiriens. Die Gesamtzahl der Usbeken auf der Welt beträgt 18,5 Millionen Menschen.
Die Kirgisen (etwa 41,7 Tausend Menschen in der Russischen Föderation) sind die Hauptbevölkerung Kirgisistans (2229,7 Tausend Menschen). Sie leben auch in Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Xinjiang (VRC) und der Mongolei. Die gesamte kirgisische Bevölkerung der Welt beträgt mehr als 2,5 Millionen Menschen.
Karakalpaken (6,2 Tausend Menschen) leben in der Russischen Föderation hauptsächlich in Städten (73,7 %), obwohl sie in Zentralasien eine überwiegend ländliche Bevölkerung darstellen. Die Gesamtzahl der Karakalpaken übersteigt 423,5
Tausend Menschen, davon leben 411,9 in Usbekistan
Karatschai (150,3 Tausend Menschen) sind die indigene Bevölkerung von Karatschai (in Karatschai-Tscherkessien), wo die meisten von ihnen leben (über 129,4 Tausend Menschen). Karatschais leben auch in Kasachstan, Zentralasien, der Türkei, Syrien und den USA. Sie sprechen die Karatschai-Balkarische Sprache.
Balkaren (78,3 Tausend Menschen) sind die indigene Bevölkerung von Kabardino-Balkarien (70,8 Tausend Menschen). Sie leben auch in Kasachstan und Kirgisistan. Ihre Gesamtzahl erreicht 85,1
Tausend Menschen Balkaren und verwandte Karatschais sind sunnitische Muslime.
Kumyks (277,2 Tausend Menschen, davon in Dagestan - 231,8 Tausend Menschen, in Tschetschenien-Inguschetien - 9,9 Tausend Menschen, in Nordossetien - 9,5 Tausend Menschen; Gesamtzahl - 282,2
tausend Menschen) - die indigene Bevölkerung der Kumyk-Ebene und der Ausläufer von Dagestan. Die Mehrheit (97,4 %) behielt ihre Muttersprache – Kumyk.
Die Nogais (73,7 Tausend Menschen) sind in Dagestan (28,3 Tausend Menschen), Tschetschenien (6,9 Tausend Menschen) und der Region Stawropol ansässig. Sie leben auch in der Türkei, Rumänien und einigen anderen Ländern. Die Nogai-Sprache ist in die Dialekte Karanogai und Kuban unterteilt. Gläubige Nogais sind sunnitische Muslime.
Die Shors (der Eigenname der Shors) erreichen eine Bevölkerung von 15,7 Tausend Menschen. Die Shors sind die indigene Bevölkerung der Region Kemerowo (Bergschoria); sie leben auch in Chakassien und der Altai-Republik. Gläubige Shors sind orthodoxe Christen.
TÜRKISCHE SPRACHEN, eine Sprachfamilie, die von der Türkei im Westen bis Xinjiang im Osten und von der Küste des Ostsibirischen Meeres im Norden bis nach Khorasan im Süden verbreitet ist. Sprecher dieser Sprachen leben kompakt in den GUS-Staaten (Aserbaidschaner – in Aserbaidschan, Turkmenen – in Turkmenistan, Kasachen – in Kasachstan, Kirgisen – in Kirgisistan, Usbeken – in Usbekistan; Kumyken, Karatschais, Balkaren, Tschuwaschen, Tataren, Baschkiren, Nogais, Jakuten, Tuwiner, Chakassien, Altai-Gebirge – in Russland; Gagausen – in der Republik Transnistrien) und darüber hinaus – in der Türkei (Türken) und China (Uiguren). Derzeit beträgt die Gesamtzahl der Sprecher türkischer Sprachen etwa 120 Millionen. Die türkische Sprachfamilie ist Teil der Altai-Makrofamilie.
Im allerersten (3. Jahrhundert v. Chr., laut Glottochronologie) trennte sich die bulgarische Gruppe von der prototürkischen Gemeinschaft (nach anderer Terminologie - R-Sprachen). Der einzige lebende Vertreter dieser Gruppe ist die Tschuwaschische Sprache. Einzelne Glossen sind in schriftlichen Denkmälern und Entlehnungen in Nachbarsprachen aus den mittelalterlichen Sprachen der Wolga- und Donaubulgaren bekannt. Die übrigen Turksprachen („Common Turkic“ oder „Z-Sprachen“) werden üblicherweise in 4 Gruppen eingeteilt: „südwestliche“ oder „Oguz“-Sprachen (Hauptvertreter: Türkisch, Gagausisch, Aserbaidschanisch, Turkmenisch, Afsharisch, Küstensprachen). ( Usbekisch, Uigurisch), „nordöstliche“ Sprachen – eine genetisch heterogene Gruppe, darunter: a) die jakutische Untergruppe (jakutische und dolganische Sprachen), die sich nach glottochronologischen Daten vor ihrem endgültigen Zusammenbruch vom gemeinsamen Türkischen trennte, im 3. Jahrhundert. ANZEIGE; b) Sayan-Gruppe (tuwinische und tofalarische Sprachen); c) Chakass-Gruppe (Chakass, Shor, Chulym, Saryg-Yugur); d) Gorno-Altai-Gruppe (Oirot, Teleut, Tuba, Lebedin, Kumandin). Die südlichen Dialekte der Gorno-Altai-Gruppe ähneln in einer Reihe von Parametern der kirgisischen Sprache und bilden zusammen die „zentralöstliche Gruppe“ der Turksprachen; einige Dialekte der usbekischen Sprache gehören eindeutig zur Nogai-Untergruppe der Kipchak-Gruppe; Khorezm-Dialekte der usbekischen Sprache gehören zur Oghuz-Gruppe; Einige der sibirischen Dialekte der tatarischen Sprache nähern sich dem Tschulym-Türkischen an.
Die frühesten entzifferten schriftlichen Denkmäler der Türken stammen aus dem 7. Jahrhundert. ANZEIGE (Stelen in Runenschrift, gefunden am Orchon-Fluss im Norden der Mongolei). Im Laufe ihrer Geschichte verwendeten die Türken die türkische Runenschrift (die offenbar auf die sogdische Schrift zurückgeht), die uigurische Schrift (die später von ihnen an die Mongolen weitergegeben wurde), Brahmi, die manichäische Schrift und die arabische Schrift. Derzeit sind Schriftsysteme üblich, die auf dem arabischen, lateinischen und kyrillischen Alphabet basieren.
Historischen Quellen zufolge tauchen Informationen über die Turkvölker erstmals im Zusammenhang mit dem Auftreten der Hunnen auf der historischen Bühne auf. Das Steppenreich der Hunnen war, wie alle bekannten Formationen dieser Art, nicht monoethnisch; Nach dem uns überlieferten sprachlichen Material zu urteilen, enthielt es ein türkisches Element. Darüber hinaus beträgt die Datierung der ersten Informationen über die Hunnen (in chinesischen historischen Quellen) 4–3 Jahrhunderte. Chr. – deckt sich mit der glottochronologischen Bestimmung des Zeitpunkts der Trennung der bulgarischen Gruppe. Daher verbinden einige Wissenschaftler den Beginn der Bewegung der Hunnen direkt mit der Trennung und dem Abzug der Bulgaren nach Westen. Der Stammsitz der Türken liegt im nordwestlichen Teil der zentralasiatischen Hochebene, zwischen dem Altai-Gebirge und dem nördlichen Teil des Khingan-Gebirges. Von der südöstlichen Seite standen sie in Kontakt mit den mongolischen Stämmen, im Westen waren ihre Nachbarn die indogermanischen Völker des Tarim-Beckens, im Nordwesten die Ural- und Jenissei-Völker, im Norden die Tungusen. Mandschus.
Bis zum 1. Jahrhundert. Chr. Im 4. Jahrhundert zogen einzelne Hunnenstammesgruppen in das Gebiet des heutigen Südkasachstans. ANZEIGE Der Einmarsch der Hunnen in Europa beginnt Ende des 5. Jahrhunderts. In byzantinischen Quellen erscheint das Ethnonym „Bulgaren“, das eine Konföderation von Stämmen hunnischen Ursprungs bezeichnet, die die Steppe zwischen Wolga- und Donaubecken bewohnten. Anschließend wird die Bulgaren-Konföderation in die Teile Wolga-Bulgaren und Donau-Bulgaren aufgeteilt.
Nach der Abspaltung der „Bulgaren“ blieben die verbliebenen Türken bis zum 6. Jahrhundert im Gebiet in der Nähe ihrer angestammten Heimat. n. Chr., als sie nach dem Sieg über die Ruan-Rhuan-Konföderation (Teil der Xianbi, vermutlich die Proto-Mongolen, die einst die Hunnen besiegten und verdrängten) die Turk-Konföderation bildeten, die von Mitte des 6. bis 1930 dominierte Mitte des 7. Jahrhunderts. über ein riesiges Gebiet vom Amur bis zum Irtysch. Historische Quellen geben keine Auskunft über den Zeitpunkt der Abspaltung der Vorfahren der Jakuten von der türkischen Gemeinschaft. Die einzige Möglichkeit, die Vorfahren der Jakuten mit einigen historischen Berichten in Verbindung zu bringen, besteht darin, sie mit den Kurykans der Orchon-Inschriften zu identifizieren, die der von den Turkuten absorbierten Teles-Konföderation angehörten. Sie waren zu dieser Zeit offenbar östlich des Baikalsees lokalisiert. Den Erwähnungen im jakutischen Epos nach zu urteilen, ist der Hauptvormarsch der Jakuten nach Norden mit einer viel späteren Zeit verbunden – der Erweiterung des Reiches von Dschingis Khan.
Im Jahr 583 wurde die türkische Konföderation in westliche (mit einem Zentrum in Talas) und östliche Turkuten (auch „blaue Türken“ genannt) aufgeteilt, deren Zentrum das ehemalige Zentrum des türkischen Reiches Kara-Balgasun am Orchon blieb. Anscheinend ist mit diesem Ereignis der Zusammenbruch der Turksprachen in die westlichen (Oghusen, Kiptschaken) und östlichen (Sibirien; Kirgisen; Karluken) Makrogruppen verbunden. Im Jahr 745 wurden die östlichen Turkuten von den Uiguren (südwestlich des Baikalsees ansässig und vermutlich zunächst nichttürkisch, zu diesem Zeitpunkt aber bereits türkisch) besiegt. Sowohl der osttürkische als auch der uigurische Staat erlebten einen starken kulturellen Einfluss aus China, aber sie wurden nicht weniger von den Ostiranern beeinflusst, vor allem von sogdischen Kaufleuten und Missionaren; 762 wurde der Manichäismus zur Staatsreligion des Uigurenreichs.
Im Jahr 840 wurde der auf den Orchon zentrierte Uigurenstaat von den Kirgisen (aus dem Oberlauf des Jenissei; vermutlich ebenfalls ursprünglich nichttürkisch, inzwischen aber Turkvolk) zerstört, die Uiguren flohen nach Ostturkestan, wo sie 847 sie gründeten einen Staat mit der Hauptstadt Kocho (in der Turfan-Oase). Von hier aus haben uns die wichtigsten Denkmäler der alten uigurischen Sprache und Kultur erreicht. Eine weitere Gruppe von Flüchtlingen ließ sich in der heutigen chinesischen Provinz Gansu nieder; ihre Nachkommen könnten die Saryg-Juguren sein. Auch die gesamte nordöstliche Türkengruppe, mit Ausnahme der Jakuten, kann auf das Uiguren-Konglomerat zurückgehen – als Teil der türkischen Bevölkerung des ehemaligen Uiguren-Kaganats, das bereits während der Mongolenexpansion nach Norden, tiefer in die Taiga vordrang.
Im Jahr 924 wurden die Kirgisen von den Khitanen (der Sprache nach vermutlich Mongolen) aus dem Orchon-Staat vertrieben und kehrten teilweise in den Oberlauf des Jenissei zurück, teilweise zogen sie nach Westen, zu den südlichen Ausläufern des Altai. Offenbar lässt sich die Bildung der zentralöstlichen Gruppe der Turksprachen auf diese Südaltai-Migration zurückführen.
Der Turfan-Staat der Uiguren existierte lange Zeit neben einem anderen türkischen Staat, der von den Karluken dominiert wurde – einem türkischen Stamm, der ursprünglich östlich der Uiguren lebte, aber 766 nach Westen zog und den Staat der westlichen Turkuten unterwarf , deren Stammesgruppen sich in den Steppen von Turan ausbreiteten (Region Ili-Talas, Sogdiana, Chorasan und Khorezm; während Iraner in den Städten lebten). Am Ende des 8. Jahrhunderts. Karluk Khan Yabgu konvertierte zum Islam. Die Karluken assimilierten nach und nach die im Osten lebenden Uiguren, und die uigurische Literatursprache diente als Grundlage für die Literatursprache des Karluk-Staates (Karachaniden).
Ein Teil der Stämme des westtürkischen Kaganats waren Oghusen. Darunter stach die Seldschuken-Konföderation hervor, die um die Wende des 1. Jahrtausends n. Chr. entstand. wanderte nach Westen über Khorasan nach Kleinasien. Die sprachliche Konsequenz dieser Bewegung war offenbar die Bildung der südwestlichen Gruppe türkischer Sprachen. Etwa zur gleichen Zeit (und offenbar im Zusammenhang mit diesen Ereignissen) kam es zu einer Massenmigration von Stämmen in die Wolga-Ural-Steppe und nach Osteuropa, die die ethnische Grundlage der heutigen Kiptschak-Sprachen darstellten.
Die phonologischen Systeme der Turksprachen zeichnen sich durch eine Reihe gemeinsamer Eigenschaften aus. Im Bereich des Konsonantismus sind Einschränkungen des Auftretens von Phonemen an der Position des Wortanfangs, eine Abschwächungstendenz in der Anfangsposition und Einschränkungen der Kompatibilität von Phonemen üblich. Am Anfang kommen im Original keine türkischen Wörter vor l,R,N, š ,z. Laute Plosive werden normalerweise durch Stärke/Schwäche (Ostsibirien) oder durch Dumpfheit/Stimme kontrastiert. Am Anfang eines Wortes findet sich der Gegensatz von Konsonanten in Bezug auf Taubheit/Stimmhaftigkeit (Stärke/Schwäche) nur in den Oguz- und Sayan-Gruppen; in den meisten anderen Sprachen werden am Anfang von Wörtern Labials, Dental und Back stimmhaft -Sprachige sind stimmlos. Uvulare sind in den meisten türkischen Sprachen Allophone von Velaren mit hinteren Vokalen. Die folgenden Arten historischer Veränderungen im Konsonantensystem werden als bedeutsam eingestuft. a) In der bulgarischen Gruppe gibt es in den meisten Stellungen einen stimmlosen Frikativ seitlich l fiel mit zusammen l im Ton in l; R Und R V R. In anderen türkischen Sprachen l gab š , R gab z, l Und R konserviert. In Bezug auf diesen Prozess sind alle Turkologen in zwei Lager gespalten: Einige nennen es Rotacismus-Lambdaismus, andere – Zetacismus-Sigmatismus, und ihre Nichtanerkennung oder Anerkennung der Altai-Sprachverwandtschaft ist statistisch damit verbunden. b) Intervokalisch D(ausgesprochen als interdentaler Frikativ ð) gibt R auf Tschuwaschisch T auf Jakut, D in den Sayan-Sprachen und Khalaj (eine isolierte türkische Sprache im Iran), z in der Chakass-Gruppe und J in anderen Sprachen; dementsprechend reden sie darüber R-,T-,D-,z- Und J- Sprachen.
Der Vokalismus der meisten türkischen Sprachen ist durch Synharmonismus (Ähnlichkeit der Vokale innerhalb eines Wortes) in Reihe und Rundheit gekennzeichnet; Das synharmonische System wird auch für das Prototürkische rekonstruiert. Der Synharmonismus verschwand in der Karluk-Gruppe (wodurch der Gegensatz von Velars und Uvulars dort phonologisiert wurde). In der neuen uigurischen Sprache wird wieder ein gewisser Anschein von Synharmonismus aufgebaut – der sogenannte „uigurische Umlaut“, das Vorrang breiter ungerundeter Vokale vor dem nächsten ich(was zurück nach vorne geht *ich, und nach hinten * ï ). Im Tschuwaschischen hat sich das gesamte Vokalsystem stark verändert und die alte Synharmonik ist verschwunden (ihre Spur ist die Opposition). k von velar im vorderen Wort und X aus dem Zäpfchen in einem Wort in der hinteren Reihe), aber dann wurde entlang der Reihe ein neuer Synharmonismus aufgebaut, der die aktuellen phonetischen Eigenschaften der Vokale berücksichtigte. Der lange/kurze Gegensatz der Vokale, der im Prototürkischen existierte, blieb in den jakutischen und turkmenischen Sprachen erhalten (und in Restform in anderen Oguz-Sprachen, wo stimmlose Konsonanten nach den alten langen Vokalen ausgesprochen wurden, sowie im Sajan. wo kurze Vokale vor stimmlosen Konsonanten das Zeichen der „Pharyngealisierung“ erhalten; in anderen Turksprachen verschwand es, aber in vielen Sprachen tauchten lange Vokale nach dem Verlust intervokalisch stimmhafter Vokale wieder auf (Tuvinsk. Also"Wanne"< *sagu und unter.). Im Jakutischen verwandelten sich die primären breiten Langvokale in aufsteigende Diphthonge.
In allen modernen Turksprachen gibt es eine Kraftbetonung, die morphonologisch festgelegt ist. Darüber hinaus wurden für sibirische Sprachen Ton- und Phonationskontraste festgestellt, die jedoch nicht vollständig beschrieben wurden.
Aus morphologischer Typologie gehören Turksprachen zum agglutinierenden Suffixtyp. Wenn außerdem die westtürkischen Sprachen ein klassisches Beispiel für agglutinierende Sprachen sind und fast keine Fusion aufweisen, entwickeln die östlichen Sprachen wie die mongolischen Sprachen eine starke Fusion.
Grammatische Kategorien von Namen in türkischen Sprachen – Numerus, Zugehörigkeit, Kasus. Die Reihenfolge der Affixe ist: Stamm + Affix. Zahlen + aff. Zubehör + Koffer aff. Plural h. wird normalerweise durch Hinzufügen eines Affixes zum Stamm gebildet -lar(auf Tschuwaschisch -sem). In allen Turksprachen ist die Pluralform h. ist markiert, Einheitsform. h. – unmarkiert. Insbesondere wird im generischen Sinne und bei Ziffern die Singularform verwendet. Zahlen (Kumyk. Männer bei Gördüm " Ich habe (tatsächlich) Pferde gesehen.
Fallsysteme umfassen: a) Nominativ- (oder Haupt-) Fall mit einem Nullindikator; die Form mit Nullfall-Indikator wird nicht nur als Subjekt und Nominalprädikat verwendet, sondern auch als unbestimmtes direktes Objekt, als applikative Definition und mit vielen Postpositionen; b) Akkusativ (aff. *- (ï )G) – Fall eines bestimmten direkten Objekts; c) Genitiv (aff.) – der Fall einer konkreten referentiellen Adjektivdefinition; d) Dativ-Direktiv (aff. *-a/*-ka); e) lokal (aff. *-ta); e) ablativ (aff. *-Zinn). Die jakutische Sprache baute ihr Kasussystem nach dem Vorbild der Tungus-Mandschu-Sprachen um. Normalerweise gibt es zwei Arten der Deklination: Nominal und Possessiv-Nominal (Deklination von Wörtern mit aff. Zugehörigkeit zur 3. Person; Kasusaffixe nehmen in diesem Fall eine etwas andere Form an).
Ein Adjektiv in türkischen Sprachen unterscheidet sich von einem Substantiv durch das Fehlen von Flexionskategorien. Nachdem das Adjektiv die syntaktische Funktion eines Subjekts oder Objekts erhalten hat, erhält es auch alle Flexionskategorien des Substantivs.
Pronomen ändern sich je nach Fall. Personalpronomen gibt es für die 1. und 2. Person (*) bi/ben"ICH", * si/sen"Du", * Bir"Wir", *Herr„du“) werden Demonstrativpronomen in der dritten Person verwendet. Demonstrativpronomen haben in den meisten Sprachen drei Umfangsgrade, z.B. bu"Das", šu„diese Fernbedienung“ (oder „dieses“, wenn es von Hand angegeben wird), ol"Das". Interrogativpronomen unterscheiden zwischen belebt und unbelebt ( Kim„wer“ und ne"Was").
In einem Verb ist die Reihenfolge der Affixe wie folgt: Verbstamm (+ aff. Stimme) (+ aff. Negation (- ma-)) + aff. Stimmung/Aspekt-zeitlich + aff. Konjugationen für Personen und Zahlen (in Klammern stehen Affixe, die nicht unbedingt in der Wortform vorkommen).
Stimmen des türkischen Verbs: aktiv (ohne Indikatoren), passiv (*- ïl), zurückkehren ( *-In-), gegenseitig ( * -ïš- ) und ursächlich ( *-T-,*-ïr-,*-tïr- und einige usw.). Diese Indikatoren können miteinander kombiniert werden (kum. gur-yush-"sehen", ger-yush-dir-„damit man sich sieht“ yaz-holes-„Lass dich schreiben“ Zungenloch-yl-„zum Schreiben gezwungen werden“).
Die konjugierten Formen des Verbs werden in echte verbale und nonverbale Formen unterteilt. Die ersten haben persönliche Indikatoren, die auf Zugehörigkeitsaffixe zurückgehen (außer 1 l. Plural und 3 l. Plural). Dazu gehört die kategoriale Vergangenheitsform (Aorist) im Indikativ: Verbstamm + Indikator - D- + persönliche Indikatoren: bar-d-ïm"Ich ging" oqu-d-u-lar"Sie lesen"; bedeutet eine abgeschlossene Handlung, deren Tatsache außer Zweifel steht. Dazu gehört auch die bedingte Stimmung (Verbstamm + -sa-+ persönliche Indikatoren); gewünschte Stimmung (Verbstamm + -aj- + Persönliche Indikatoren: Prototürkisch. * bar-aj-ïm"Lass mich gehen" * bar-aj-ïk"lass uns gehen"); Imperativ (reine Basis des Verbs in 2-Liter-Einheiten und Basis + in 2 l. pl. H.).
Nonverbale Formen sind historisch gesehen Gerundien und Partizipien in der Funktion eines Prädikats, die durch dieselben Prädikabilitätsindikatoren formalisiert werden wie Nominalprädikate, nämlich postpositive Personalpronomen. Zum Beispiel: alttürkisch. ( Ben)Bitte Ben„Ich bin bek“ ben anca tir ben„Ich sage es“, lit. „Ich sage es – ich.“ Es gibt verschiedene Gerundien des Präsens (oder der Gleichzeitigkeit) (Stamm + -A), unsichere Zukunft (Basis + -Vr, Wo V– Vokal unterschiedlicher Qualität), Vorrang (Stamm + -ip), gewünschte Stimmung (Stamm + -g aj); Partizip Perfekt (Stamm + -g an), postokular oder beschreibend (Stamm + -mïš), bestimmte Zukunftsform (Basis +) und viele mehr. usw. Die Affixe von Gerundien und Partizipien enthalten keine Stimmoppositionen. Partizipien mit Prädikatsaffixen sowie Gerundien mit Hilfsverben in echten und unechten verbalen Formen (zahlreiche Existenz-, Phasen-, Modalverben, Bewegungsverben, Verben „nehmen“ und „geben“ fungieren als Hilfsverben) drücken eine Vielzahl von Erfüllungsmodalitäten aus , Richtungs- und Akkommodationswerte, vgl. Kumyk Bara Bolgayman„Sieht so aus, als würde ich gehen“ ( gehen- tiefer. Gleichzeitigkeit werden- tiefer. wünschenswert -ICH), Ishley Goremen"Ich bin auf dem Weg zur Arbeit" ( arbeiten- tiefer. Gleichzeitigkeit sehen- tiefer. Gleichzeitigkeit -ICH), Sprache„Schreiben Sie es (für sich selbst) auf“ ( schreiben- tiefer. Vorrang Nimm es). In verschiedenen türkischen Sprachen werden verschiedene verbale Aktionsnamen als Infinitive verwendet.
Aus syntaktischer Typologie gehören Turksprachen zu den Sprachen der Nominativstruktur mit der vorherrschenden Wortstellung „Subjekt – Objekt – Prädikat“, Definitionspräposition, Bevorzugung von Postpositionen gegenüber Präpositionen. Es gibt ein Isafet-Design – mit dem Zugehörigkeitsindikator für das zu definierende Wort ( bei baš-ï„Pferdekopf“, lit. „Pferdekopf-sie“) In einer koordinierenden Phrase werden normalerweise alle grammatikalischen Indikatoren an das letzte Wort angehängt.
Die allgemeinen Regeln für die Bildung untergeordneter Phrasen (einschließlich Sätzen) sind zyklisch: Jede untergeordnete Kombination kann als eines der Mitglieder in jede andere eingefügt werden, und die Verbindungsindikatoren werden an das Hauptmitglied der eingebauten Kombination (das Verb) angehängt Form wird in diesem Fall zum entsprechenden Partizip oder Gerundium). Mi: Kumyk. ak saqal"weißer Bart" ak sakal-ly gishi„weißbärtiger Mann“ booth-la-ny ara-son-ja„zwischen den Kabinen“ Stand-la-ny ara-son-da-gyy el-well orta-son-da„in der Mitte des Weges zwischen den Kabinen“ sen ok atgyang„Du hast einen Pfeil abgeschossen“ Sep ok atgyanyng-ny gördyum„Ich habe gesehen, wie du den Pfeil geschossen hast“ („Du hast den Pfeil geschossen – 2 Liter Singular – Vin. Fall – ich habe gesehen“). Wenn eine prädikative Kombination auf diese Weise eingefügt wird, spricht man oft vom „Altai-Typ komplexer Sätze“; tatsächlich zeigen Turksprachen und andere altaische Sprachen eine deutliche Präferenz für solche absoluten Konstruktionen mit einem Verb in der nicht-finiten Form gegenüber Nebensätzen. Letztere werden jedoch auch verwendet; Für die Kommunikation in komplexen Sätzen werden verwandte Wörter verwendet – Fragepronomen (in Nebensätzen) und korrelative Wörter – Demonstrativpronomen (in Hauptsätzen).
Der Hauptteil des Vokabulars der türkischen Sprachen ist muttersprachlich und weist häufig Parallelen in anderen Altai-Sprachen auf. Ein Vergleich des allgemeinen Vokabulars der türkischen Sprachen ermöglicht es uns, eine Vorstellung von der Welt zu bekommen, in der die Türken während des Zusammenbruchs der prototürkischen Gemeinschaft lebten: der Landschaft, Fauna und Flora der südlichen Taiga im Osten Sibirien, an der Grenze zur Steppe; Metallurgie der frühen Eisenzeit; Wirtschaftsstruktur im gleichen Zeitraum; Transhumanz basierend auf Pferdezucht (Verwendung von Pferdefleisch als Nahrung) und Schafzucht; Landwirtschaft in Hilfsfunktion; die große Rolle der entwickelten Jagd; zwei Arten von Unterkünften – stationäres Wintergehäuse und tragbares Sommergehäuse; ziemlich entwickelte soziale Spaltung auf Stammesbasis; offenbar gewissermaßen ein kodifiziertes System der Rechtsbeziehungen im aktiven Handel; eine Reihe religiöser und mythologischer Konzepte, die für den Schamanismus charakteristisch sind. Darüber hinaus wird natürlich auch der „grundlegende“ Wortschatz wie Namen von Körperteilen, Bewegungsverben, Sinneswahrnehmungen usw. wiederhergestellt.
Zusätzlich zum ursprünglichen türkischen Vokabular verwenden moderne türkische Sprachen eine Vielzahl von Anleihen aus Sprachen, mit deren Sprechern die Türken jemals Kontakt hatten. Dabei handelt es sich in erster Linie um mongolische Entlehnungen (in den mongolischen Sprachen gibt es viele Entlehnungen aus den Turksprachen; es gibt auch Fälle, in denen ein Wort zuerst aus den Turksprachen ins Mongolische und dann zurück aus den Mongolensprachen entlehnt wurde in die türkischen Sprachen, vgl. Altuigurisch. irbii, Tuwinsk irbiš„Leopard“ > Mong. Irbis > Kirgisistan Irbis). In der jakutischen Sprache gibt es viele Tungus-Mandschu-Entlehnungen, in Tschuwaschisch und Tatarisch sind sie aus den finno-ugrischen Sprachen der Wolga-Region entlehnt (sowie umgekehrt). Ein erheblicher Teil des „kulturellen“ Vokabulars wurde entlehnt: Im alten Uigurischen gibt es viele Anleihen aus dem Sanskrit und Tibetischen, vor allem aus der buddhistischen Terminologie; in den Sprachen der muslimischen Turkvölker gibt es viele Arabismen und Persismen; In den Sprachen der Turkvölker, die Teil des Russischen Reiches und der UdSSR waren, gibt es viele russische Anleihen, darunter auch Internationalismen wie Kommunismus,Traktor,politische Wirtschaft. Andererseits gibt es in der russischen Sprache viele türkische Anleihen. Die frühesten sind Entlehnungen aus der donaubulgarischen Sprache ins Altkirchenslawische ( Buch, tropfen„Idol“ – im Wort Tempel„heidnischer Tempel“ usw.), von dort kamen sie ins Russische; es gibt auch Entlehnungen aus dem Bulgarischen ins Altrussische (sowie in andere slawische Sprachen): Serum(gemeines Türkisch) *Joghurt, Ausbuchtung. *suvart), Schleimbeutel„Persischer Seidenstoff“ (Tschuwaschisch. porzin< *bariun< Mittelpersisch *aparešum; Der Handel zwischen der vormongolischen Rus und Persien verlief entlang der Wolga durch die Großbulgaren. Ein großer Teil des kulturellen Vokabulars wurde im 14.–17. Jahrhundert aus spätmittelalterlichen Turksprachen in die russische Sprache übernommen. (zur Zeit der Goldenen Horde und noch später, in Zeiten regen Handels mit den umliegenden Turkstaaten: Arsch, Bleistift, Rosine,Schuh, Eisen,Altyn,Arschin,Kutscher,Armenisch,Graben,getrocknete Aprikosen und viele mehr usw.). In späteren Zeiten entlehnte die russische Sprache nur Wörter aus dem Türkischen, die lokale türkische Realitäten bezeichneten ( Schneeleopard,Ayran,kobyz,Sultaninen,Dorf,Ulme). Entgegen der landläufigen Meinung gibt es im obszönen (obszönen) Vokabular des Russischen keine türkischen Anleihen; fast alle dieser Wörter sind slawischen Ursprungs.
eine Sprachfamilie, die von zahlreichen Völkern und Nationalitäten der UdSSR, der Türkei, einem Teil der Bevölkerung Irans, Afghanistans, der Mongolei, Chinas, Rumäniens, Bulgariens, Jugoslawiens und Albaniens gesprochen wird. Die Frage nach der genetischen Verwandtschaft dieser Sprachen mit den Altai-Sprachen steht auf der Ebene einer Hypothese, die die Vereinigung der türkischen, tungusisch-mandschurischen und mongolischen Sprachen beinhaltet. Einer Reihe von Wissenschaftlern zufolge (E. D. Polivanov, G. J. Ramstedt und andere) erweitert sich der Umfang dieser Familie um die koreanischen und japanischen Sprachen. Es gibt auch die Ural-Altaische Hypothese (M. A. Kastren, O. Bötlingk, G. Winkler, O. Donner, Z. Gombots und andere), nach der T. Ya. sowie andere Altai-Sprachen zusammen mit dem Finno -Ugrische Sprachen sind Sprachen der Ural-Altai-Makrofamilie. In der altaischen Literatur wird die typologische Ähnlichkeit der türkischen, mongolischen und tungusisch-mandschurischen Sprachen manchmal mit genetischer Verwandtschaft verwechselt. Die Widersprüche der Altai-Hypothese hängen zum einen mit der unklaren Verwendung der vergleichenden historischen Methode bei der Rekonstruktion des Altai-Archetyps und zum anderen mit dem Fehlen präziser Methoden und Kriterien zur Unterscheidung ursprünglicher und entlehnter Wurzeln zusammen.
Die Bildung einzelner nationaler T. i. Dem gingen zahlreiche und komplexe Migrationen ihrer Träger voraus. Im 5. Jahrhundert die Bewegung der Gur-Stämme von Asien in die Kama-Region begann; aus dem 5.-6. Jahrhundert Turkstämme aus Zentralasien (Oguz und andere) begannen, nach Zentralasien zu ziehen; im 10.-12. Jahrhundert. das Siedlungsgebiet der alten Uiguren- und Oghusenstämme erweiterte sich (von Zentralasien bis Ostturkestan, Zentral- und Kleinasien); die Konsolidierung der Vorfahren der Tuwiner, Chakassien und Bergaltaier fand statt; zu Beginn des 2. Jahrtausends zogen kirgisische Stämme vom Jenissei in das heutige Territorium Kirgisistans; im 15. Jahrhundert Kasachische Stämme konsolidierten sich.
[Einstufung]
Nach der modernen Verbreitungsgeographie werden T. i unterschieden. die folgenden Gebiete: Zentral- und Südostasien, Süd- und Westsibirien, Wolga-Kama, Nordkaukasus, Transkaukasien und die Schwarzmeerregion. In der Turkologie gibt es mehrere Klassifizierungsschemata.
V. A. Bogoroditsky teilte T. I. in 7 Gruppen: nordöstlich(Jakutische, Karagas- und Tuwinische Sprachen); Chakassisch (Abakan), zu dem die Dialekte Sagai, Beltir, Koibal, Kachin und Kyzyl der chakassischen Bevölkerung der Region gehörten; Altai mit einem südlichen Zweig (Altai- und Teleut-Sprachen) und einem nördlichen Zweig (Dialekte der sogenannten Tschernew-Tataren und einige andere); Westsibirisch, das alle Dialekte der sibirischen Tataren umfasst; Wolga-Ural-Region(tatarische und baschkirische Sprachen); Zentralasiatisch(Uigurische, kasachische, kirgisische, usbekische, karakalpakische Sprachen); südwestlich(Turkmenische, aserbaidschanische, kumykische, gagausische und türkische Sprachen).
Die sprachlichen Kriterien dieser Klassifikation waren nicht ausreichend vollständig und überzeugend, ebenso wie die rein phonetischen Merkmale, die die Grundlage für die Klassifikation von V. V. Radlov bildeten, der 4 Gruppen unterschied: östlich(Sprachen und Dialekte der Altai-, Ob-, Jenissei-Türken und Tschulym-Tataren, Karagas-, Chakass-, Shor- und Tuvan-Sprachen); Western(Adverbien der Tataren Westsibiriens, der kirgisischen, kasachischen, baschkirischen, tatarischen und bedingt karakalpakischen Sprachen); Zentralasiatisch(Uigurische und usbekische Sprachen) und Süd-(Turkmenisch, Aserbaidschanisch, Türkische Sprachen, einige südliche Küstendialekte der krimtatarischen Sprache); Radlov hob besonders die jakutische Sprache hervor.
F. E. Korsh, der als erster morphologische Merkmale als Grundlage für die Klassifizierung verwendete, gab zu, dass T. i. ursprünglich in nördliche und südliche Gruppen unterteilt; später spaltete sich die südliche Gruppe in eine östliche und eine westliche.
In dem von A. N. Samoilovich (1922) vorgeschlagenen verfeinerten Schema hat T. i. in 6 Gruppen eingeteilt: P-Gruppe oder Bulgarisch (die Tschuwaschische Sprache war auch darin enthalten); d-Gruppe oder Uigurisch, ansonsten nordöstlich (zusätzlich zum Altuigurischen gehörten dazu die Sprachen Tuvanisch, Tofalarisch, Jakutisch und Chakassisch); Tau-Gruppe oder Kypchak, ansonsten nordwestlich (tatarische, baschkirische, kasachische, kirgisische Sprachen, Altai-Sprache und ihre Dialekte, Karatschai-Balkar, Kumyk, krimtatarische Sprachen); tag-lyk-group oder Chagatai, ansonsten südöstlich (moderne uigurische Sprache, usbekische Sprache ohne ihre kiptschakischen Dialekte); tag-ly-Gruppe oder Kiptschak-Turkmenisch (mittlere Dialekte - Chiwa-Usbekisch und Chiwa-Sart, die ihre eigenständige Bedeutung verloren haben); Ol-Gruppe, ansonsten südwestlich, oder Oghusen (türkische, aserbaidschanische, turkmenische, krimtatarische Dialekte an der Südküste).
Anschließend wurden neue Schemata vorgeschlagen, die jeweils darauf abzielten, die Verteilung der Sprachen in Gruppen zu klären und auch alte Turksprachen einzubeziehen. Ramstedt identifiziert beispielsweise 6 Hauptgruppen: Tschuwaschische Sprache; Jakutische Sprache; nördliche Gruppe (nach A.M.O. Ryasyanen - nordöstlich), der alle T. I zugeordnet sind. und Dialekte des Altai und der umliegenden Gebiete; westliche Gruppe (nach Räsänen - nordwestlich) - Kirgisische, kasachische, karakalpakische, nogaische, kumykische, karachaiische, balkarische, karäische, tatarische und baschkirische Sprachen; die toten kumanischen und kiptschakischen Sprachen gehören ebenfalls zu dieser Gruppe; östliche Gruppe (nach Räsänen - südöstlich) - Neue uigurische und usbekische Sprachen; südliche Gruppe (laut Räsänen - südwestlich) - turkmenische, aserbaidschanische, türkische und gagausische Sprachen. Einige Variationen dieser Art von Schema werden durch die von I. Benzing und K. G. Menges vorgeschlagene Klassifizierung dargestellt. Die Klassifizierung von S. E. Malov basiert auf einem chronologischen Merkmal: Alle Sprachen werden in „alt“, „neu“ und „neueste“ unterteilt.
Die Klassifikation von N. A. Baskakov unterscheidet sich grundlegend von den vorherigen; Nach seinen Grundsätzen ist die Klassifizierung von T. i. ist nichts anderes als eine Periodisierung der Entwicklungsgeschichte der Turkvölker und -sprachen in der ganzen Vielfalt kleiner Clanverbände des Ursystems, die entstanden und zusammenbrachen, und dann großer Stammesverbände, die mit demselben Ursprung entstanden Gemeinschaften, die sich in der Zusammensetzung der Stämme und damit in der Zusammensetzung der Stammessprachen unterschieden.
Die betrachteten Klassifikationen mit all ihren Mängeln haben dazu beigetragen, Gruppen von T. i. zu identifizieren, die genetisch am engsten verwandt sind. Die besondere Zuordnung der Sprachen Tschuwaschisch und Jakut ist gerechtfertigt. Um eine genauere Klassifizierung zu entwickeln, ist es notwendig, den Satz differenzieller Merkmale zu erweitern und dabei die äußerst komplexe Dialekteinteilung von T. i. zu berücksichtigen. Das allgemein akzeptierte Klassifizierungsschema zur Beschreibung einzelner T. i. Das von Samoilovich vorgeschlagene Schema bleibt bestehen.
[Typologie]
Typologisch T. I. gehören zu den agglutinierenden Sprachen. Die Wurzel (Basis) des Wortes kann, ohne mit Klassenindikatoren belastet zu sein (in T. Ya. gibt es keine Klasseneinteilung der Substantive), im Nominativ in ihrer reinen Form erscheinen, wodurch sie zum organisierenden Zentrum von wird das gesamte Deklinationsparadigma. Die axiale Struktur des Paradigmas, d. h. eine Struktur, die auf einem strukturellen Kern basiert, beeinflusste die Natur phonetischer Prozesse (Tendenz zur Aufrechterhaltung klarer Grenzen zwischen Morphemen, ein Hindernis für die Verformung der Paradigmenachse selbst und für die Verformung der Wortbasis). , usw.) . Ein Begleiter der Agglutination bei T. i. ist Synharmonismus.
[Phonetik]
Es manifestiert sich konsequenter in T. I. Harmonie auf der Grundlage von Palatalität – Nicht-Palatalität, vgl. Tour. evler-in-de „in ihren Häusern“, Karatschai-Balk. bar-ai-ym „Ich gehe“ usw. Labialer Synharmonismus in verschiedenen T. i. in unterschiedlichem Ausmaß entwickelt.
Es gibt eine Hypothese über das Vorhandensein von 8 Vokalphonemen für den frühen gemeinsamen türkischen Staat, die kurz und lang sein könnten: a, ә, o, u, ө, ү, ы, и. Die Frage ist, ob ich in T war. geschlossen /e/. Ein charakteristisches Merkmal weiterer Veränderungen im alttürkischen Vokalismus ist der Verlust langer Vokale, der die Mehrheit der T. i. Sie sind hauptsächlich in den Sprachen Jakut, Turkmenisch und Khalaj erhalten; in anderen T. I. Nur ihre einzelnen Reliquien sind erhalten geblieben.
Im Tatarischen, Baschkirischen und Alttschuwaschischen gab es einen Übergang von /a/ in den ersten Silben vieler Wörter zum labialisierten, zurückgedrängten /a°/, vgl. *kara „schwarz“, alttürkisch, kasachisch. Kara, aber tat. ka°ra; *bei „Pferd“, alttürkisch, türkisch, aserbaidschanisch, kasachisch. at, aber tat., bashk. a°t usw. Es gab auch einen Übergang von /a/ zu labialisiertem /o/, typisch für die usbekische Sprache, vgl. *bash ‚Kopf‘, Usbekisch. Bosch Es gibt einen Umlaut /a/ unter dem Einfluss von /i/ der nächsten Silbe in der uigurischen Sprache (eti „sein Pferd“ anstelle von ata); das kurze ә bleibt in den aserbaidschanischen und neuuigurischen Sprachen erhalten (vgl. kәl‑ ‚kommen‘, aserbaidschanisch gәl′‑, uigurisch. kәl‑), während ә > e in den meisten T. i. (vgl. Tur. gel‑, Nogai, Alt., Kirg. kel‑ usw.). Die tatarischen, baschkirischen, chakassischen und teilweise tschuwaschischen Sprachen zeichnen sich durch den Übergang ә > und aus, vgl. *әт ‚Fleisch‘, Tat. Es. In den Sprachen Kasachisch, Karakalpak, Nogai und Karatschai-Balkar wird die diphthongoide Aussprache einiger Vokale am Wortanfang festgestellt, in den Sprachen Tuvan und Tofalar – das Vorhandensein pharyngealisierter Vokale.
Die häufigste Form der Gegenwart ist -a, die manchmal auch die Bedeutung der Zukunftsform hat (in den Sprachen Tatar, Baschkirisch, Kumyk, Krimtatarisch, im T. Ya. von Zentralasien, Dialekten der Tataren von Sibirien). In allen T.I. es gibt eine Gegenwarts-Zukunfts-Form in ‑ar/‑yr. Die türkische Sprache zeichnet sich durch die Präsensform in ‑yor aus, die turkmenische Sprache durch die Präsensform in ‑yar. Die Gegenwartsform dieses Moments in ‑makta/‑makhta/‑mokda kommt in den Sprachen Türkisch, Aserbaidschanisch, Usbekisch, Krimtatarisch, Turkmenisch, Uigurisch und Karakalpak vor. In T.I. Es besteht die Tendenz, spezielle Formen des Präsens eines bestimmten Moments zu schaffen, die nach dem Modell „Gerundpartizip in a- oder -yp + Präsensform einer bestimmten Gruppe von Hilfsverben“ gebildet werden.
Die gebräuchliche türkische Form der Vergangenheitsform on -dy zeichnet sich durch ihre semantische Kapazität und aspektuelle Neutralität aus. Bei der Entwicklung von T. i. Es besteht eine ständige Tendenz, die Vergangenheitsform mit Aspektbedeutungen zu bilden, insbesondere solchen, die die Dauer angeben. Handlung in der Vergangenheit (vgl. unbestimmter unvollkommener Typus des karäischen alyr eat „Ich nahm“). In vielen T.I. (hauptsächlich Kypchak) gibt es ein Perfekt, das durch Anhängen von Personalendungen des ersten Typs (phonetisch modifizierte Personalpronomen) an das Partizip in ‑kan/‑gan gebildet wird. Eine etymologisch verwandte Form in ‑an existiert in der turkmenischen Sprache und in ‑ny in der tschuwaschischen Sprache. In den Sprachen der Oguz-Gruppe ist das Perfekt für -mouse üblich, und in der jakutischen Sprache gibt es eine etymologisch verwandte Form für -byt. Das Plusquaperfekt hat den gleichen Stamm wie das Perfekt, kombiniert mit den Präteritum-Stammformen des Hilfsverbs „sein“.
In allen T.-Sprachen, mit Ausnahme der Tschuwaschischen Sprache, gibt es für die Zukunftsform (Gegenwart-Zukunft) einen Indikator ‑yr/‑ar. Die oghusischen Sprachen zeichnen sich durch die Form des Futur-Kategorials in ‑adzhak/‑achak aus; es ist auch in einigen Sprachen des südlichen Raums üblich (Usbekisch, Uigurisch).
Zusätzlich zum Indikativ in T. i. Es gibt eine wünschenswerte Stimmung mit den häufigsten Indikatoren – gai (für Kiptschak-Sprachen), -a (für Oguz-Sprachen), Imperativ mit eigenem Paradigma, wobei der reine Verbstamm einen an den 2. Buchstaben gerichteten Befehl ausdrückt. Einheiten h., bedingt, mit 3 Bildungsmodellen mit besonderen Indikatoren: -sa (für die meisten Sprachen), -sar (in Orchon, alten uigurischen Denkmälern, sowie in türkischen Texten des 10.-13. Jahrhunderts aus Ostturkestan, aus der Moderne Sprachen in phonetisch transformierter Form, die nur auf Jakutisch erhalten sind), -san (in der Tschuwaschischen Sprache); Die obligatorische Stimmung findet sich vor allem in den Sprachen der Oghusengruppe (vgl. Aserbaidschanisch ҝәлмәлјәм „Ich muss kommen“).
T. I. haben eine reale (mit dem Stamm übereinstimmende), passive (Indikator ‑l, am Stamm befestigte), reflexive (Indikator ‑n), reziproke (Indikator ‑ш) und erzwungene (Indikatoren sind vielfältig, am häufigsten sind ‑Löcher/‑ tyr, ‑t, ‑ yz, -gyz) Versprechen.
Verbstamm in T. i. gleichgültig gegenüber dem Ausdruck des Aspekts. Aspektschattierungen können separate Tempusformen sowie spezielle komplexe Verben haben, deren Aspekteigenschaften durch Hilfsverben angegeben werden.
- Melioransky P. M., arabischer Philologe für die türkische Sprache, St. Petersburg, 1900;
- Bogoroditsky V. A., Einführung in die tatarische Linguistik, Kasan, 1934; 2. Aufl., Kasan, 1953;
- Malov S. E., Monuments of Ancient Turkic Writing, M.-L., 1951;
- Studien zur vergleichenden Grammatik türkischer Sprachen, Teile 1–4, M., 1955–62;
- Baskakow N. A., Einführung in das Studium der Turksprachen, M., 1962; 2. Aufl., M., 1969;
- sein, Historisch-typologische Phonologie türkischer Sprachen, M., 1988;
- Schtscherbak A. M., Vergleichende Phonetik türkischer Sprachen, Leningrad, 1970;
- Sevortyan E.V., Etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprachen, [Bd. 1-3], M., 1974-80;
- Serebrennikow B.A., Gadschijewa N.Z., Vergleichend-historische Grammatik türkischer Sprachen, Baku, 1979; 2. Aufl., M., 1986;
- Vergleichend-historische Grammatik der Turksprachen. Phonetik. Rep. Hrsg. E. R. Tenishev, M., 1984;
- Dasselbe, Morphology, M., 1988;
- Grønbech K., Der Türkische Sprachbau, v. 1, Kph., 1936;
- Gabain A., Alttürkische Grammatik, Lpz., 1941; 2. Aufl., Lpz., 1950;
- Brockelmann C., Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens, Leiden, 1954;
- Räsänen M. R., Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Hels., 1957 (Studia Orientalia, XXI);
- Philologiae Turcicae fundamenta, t. 1-2, 1959-64.
Sie sind über ein weites Gebiet unseres Planeten verteilt, vom kalten Kolyma-Becken bis zur südwestlichen Küste des Mittelmeers. Die Türken gehören keinem bestimmten Rassentyp an; selbst unter einem Volk gibt es sowohl Kaukasier als auch Mongoloiden. Sie sind größtenteils Muslime, aber es gibt auch Völker, die sich zum Christentum, zum traditionellen Glauben und zum Schamanismus bekennen. Das Einzige, was fast 170 Millionen Menschen verbindet, ist der gemeinsame Ursprung der heute von den Türken gesprochenen Sprachgruppe. Jakut und Türke sprechen alle verwandte Dialekte.
Starker Zweig des Altai-Baums
Unter manchen Wissenschaftlern herrscht noch immer Streit darüber, zu welcher Sprachfamilie die türkische Sprachgruppe gehört. Einige Linguisten identifizierten es als eine separate große Gruppe. Die heute am weitesten verbreitete Hypothese ist jedoch, dass diese verwandten Sprachen zur großen Altai-Familie gehören.
Einen wesentlichen Beitrag zu diesen Studien leistete die Entwicklung der Genetik, die es ermöglichte, die Geschichte ganzer Nationen anhand der Spuren einzelner Fragmente des menschlichen Genoms zu verfolgen.
Es war einmal eine Gruppe von Stämmen in Zentralasien, die dieselbe Sprache sprachen – der Vorfahre der modernen türkischen Dialekte, aber im 3. Jahrhundert. Chr e. ein separater bulgarischer Zweig, der vom großen Stamm getrennt ist. Die einzigen Menschen, die heute Sprachen der bulgarischen Gruppe sprechen, sind die Tschuwaschischen. Ihr Dialekt unterscheidet sich deutlich von anderen verwandten Dialekten und sticht als besondere Untergruppe hervor.
Einige Forscher schlagen sogar vor, die Tschuwaschische Sprache einer eigenen Gattung der großen Altai-Makrofamilie zuzuordnen.
Klassifizierung der südöstlichen Richtung
Andere Vertreter der türkischen Sprachgruppe werden üblicherweise in 4 große Untergruppen eingeteilt. Es gibt Unterschiede im Detail, aber der Einfachheit halber können wir die gebräuchlichste Methode verwenden.
Oguz oder südwestliche Sprachen, zu denen Aserbaidschanisch, Türkisch, Turkmenisch, Krimtatarisch und Gagausisch gehören. Vertreter dieser Völker sprechen sehr ähnlich und können sich auch ohne Übersetzer gut verstehen. Daher der enorme Einfluss der starken Türkei in Turkmenistan und Aserbaidschan, deren Bewohner Türkisch als ihre Muttersprache betrachten.
Zur türkischen Gruppe der Altai-Sprachfamilie gehören auch die Kiptschak- oder Nordwestsprachen, die hauptsächlich auf dem Territorium der Russischen Föderation gesprochen werden, sowie Vertreter der Völker Zentralasiens mit nomadischen Vorfahren. Tataren, Baschkiren, Karatschais, Balkaren, Völker Dagestans wie die Nogais und Kumyken sowie Kasachen und Kirgisen – sie alle sprechen verwandte Dialekte der Kiptschak-Untergruppe.

Die südöstlichen oder Karluk-Sprachen werden stark durch die Sprachen zweier großer Völker repräsentiert – der Usbeken und der Uiguren. Allerdings entwickelten sie sich fast tausend Jahre lang getrennt voneinander. Wenn die usbekische Sprache den kolossalen Einfluss von Farsi und der arabischen Sprache erfahren hat, dann haben die Uiguren, Bewohner Ostturkestans, über viele Jahre hinweg eine Vielzahl chinesischer Anleihen in ihren Dialekt eingeführt.
Nordtürkische Sprachen
Die Geographie der türkischen Sprachgruppe ist breit und vielfältig. Auch die Jakuten, Altaier im Allgemeinen, einige indigene Völker Nordost-Eurasiens, vereinen sich zu einem eigenen Zweig des großen Turkbaums. Nordöstliche Sprachen sind recht heterogen und werden in mehrere separate Gattungen unterteilt.
Die Sprachen Jakut und Dolgan trennten sich vom einzigen türkischen Dialekt, und dies geschah im 3. Jahrhundert. N. e.
Die Sayan-Sprachgruppe der türkischen Familie umfasst tuvanische und tofalarische Sprachen. Chakassier und Bewohner des Berges Shoria sprechen Sprachen der Chakass-Gruppe.
Altai ist die Wiege der türkischen Zivilisation; bis heute sprechen die Ureinwohner dieser Orte die Sprachen Oirot, Teleut, Lebedin und Kumandin der Altai-Untergruppe.
Ereignisse in einer harmonischen Klassifizierung
Allerdings ist bei dieser bedingten Aufteilung nicht alles so einfach. Der Prozess der national-territorialen Abgrenzung, der in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts auf dem Territorium der zentralasiatischen Republiken der UdSSR stattfand, betraf auch eine so subtile Angelegenheit wie die Sprache.
Alle Bewohner der usbekischen SSR wurden Usbeken genannt, und es wurde eine einzige Version der literarischen usbekischen Sprache übernommen, die auf den Dialekten des Kokand-Khanats basierte. Allerdings zeichnet sich die usbekische Sprache auch heute noch durch einen ausgeprägten Dialektismus aus. Einige Dialekte von Khorezm, dem westlichsten Teil Usbekistans, ähneln eher den Sprachen der Oghuz-Gruppe und eher dem Turkmenischen als der literarischen usbekischen Sprache.

In einigen Gebieten werden Dialekte gesprochen, die zur Nogai-Untergruppe der Kiptschak-Sprachen gehören. Daher kommt es häufig vor, dass ein Einwohner von Ferghana Schwierigkeiten hat, einen Eingeborenen aus Kaschkadarja zu verstehen, der seiner Meinung nach seine Muttersprache schamlos verfälscht.
Bei anderen Vertretern der Völker der türkischen Sprachgruppe – den Krimtataren – ist die Situation ungefähr gleich. Die Sprache der Bewohner des Küstenstreifens ist fast identisch mit der Türkischen, die natürlichen Steppenbewohner sprechen jedoch einen eher kiptschakischen Dialekt.
Alte Geschichte
Die Türken betraten die weltgeschichtliche Arena erstmals im Zeitalter der großen Völkerwanderung. Im genetischen Gedächtnis der Europäer herrscht noch ein Schauder vor dem Hunneneinfall durch Attila im 4. Jahrhundert. N. e. Das Steppenreich war eine bunte Formation zahlreicher Stämme und Völker, das türkische Element war jedoch immer noch vorherrschend.
Über den Ursprung dieser Völker gibt es viele Versionen, die meisten Forscher vermuten jedoch, dass der Stammsitz der heutigen Usbeken und Türken im nordwestlichen Teil der zentralasiatischen Hochebene liegt, im Gebiet zwischen Altai und dem Khingar-Kamm. Diese Version wird auch von den Kirgisen vertreten, die sich als direkte Erben des großen Reiches betrachten und noch immer nostalgisch darüber sind.
Die Nachbarn der Türken waren die Mongolen, die Vorfahren der heutigen indogermanischen Völker, die Ural- und Jenissei-Stämme sowie die Mandschu. In enger Interaktion mit ähnlichen Völkern begann sich die türkische Gruppe der Altai-Sprachfamilie zu bilden.
Verwechslung mit Tataren und Bulgaren
Im ersten Jahrhundert n. Chr e. Einzelne Stämme beginnen mit der Abwanderung in Richtung Südkasachstan. Die berühmten Hunnen fielen im 4. Jahrhundert in Europa ein. Damals trennte sich der bulgarische Zweig vom türkischen Zweig und es entstand eine riesige Konföderation, die in Donau und Wolga aufgeteilt wurde. Die heutigen Bulgaren auf dem Balkan sprechen mittlerweile eine slawische Sprache und haben ihre türkischen Wurzeln verloren.
Bei den Wolgabulgaren war es umgekehrt. Sie sprechen immer noch Turksprachen, nennen sich aber nach der Mongoleninvasion Tataren. Die eroberten türkischen Stämme, die in den Steppen der Wolga lebten, nahmen den Namen der Tataren an – ein legendärer Stamm, mit dem Dschingis Khan seine Feldzüge begann, der in den Kriegen längst verschwunden war. Sie nannten ihre Sprache, die sie zuvor Bulgarisch genannt hatten, auch Tatarisch.

Der einzige lebende Dialekt des bulgarischen Zweigs der türkischen Sprachgruppe ist Tschuwaschisch. Die Tataren, ein weiterer Nachkomme der Bulgaren, sprechen tatsächlich eine Variante der späteren Kiptschak-Dialekte.
Von Kolyma bis zum Mittelmeer
Zu den Völkern der türkischen Sprachgruppe zählen die Bewohner der rauen Regionen des berühmten Kolyma-Beckens, der Ferienstrände des Mittelmeers, des Altai-Gebirges und der flachen Steppen Kasachstans. Die Vorfahren der heutigen Türken waren Nomaden, die den gesamten eurasischen Kontinent bereisten. Zweitausend Jahre lang interagierten sie mit ihren Nachbarn, die Iraner, Araber, Russen und Chinesen waren. In dieser Zeit kam es zu einer unvorstellbaren Vermischung von Kulturen und Blut.
Heute ist es nicht einmal mehr möglich, die Rasse zu bestimmen, zu der die Türken gehören. Einwohner der Türkei, Aserbaidschaner und Gagausen gehören zur mediterranen Gruppe der kaukasischen Rasse; es gibt praktisch keine Männer mit schrägen Augen und gelblicher Haut. Doch die Jakuten, Altaier, Kasachen, Kirgisen – sie alle tragen in ihrem Aussehen ein ausgeprägtes mongolisches Element.

Selbst unter Völkern, die dieselbe Sprache sprechen, ist Rassenvielfalt zu beobachten. Unter den Tataren von Kasan findet man blauäugige Blonde und Schwarzhaarige mit schrägen Augen. Das Gleiche ist in Usbekistan zu beobachten, wo es unmöglich ist, auf das Aussehen eines typischen Usbeken zu schließen.
Glaube
Die meisten Türken sind Muslime und bekennen sich zum sunnitischen Zweig dieser Religion. Nur in Aserbaidschan bekennen sie sich zum Schiismus. Einige Völker behielten jedoch entweder ihren alten Glauben bei oder wurden Anhänger anderer großer Religionen. Die meisten Tschuwaschen und Gagausen bekennen sich zum Christentum in seiner orthodoxen Form.
Im Nordosten Eurasiens halten einzelne Völker weiterhin am Glauben ihrer Vorfahren fest; bei den Jakuten, Altaiern und Tuwinern erfreuen sich traditionelle Glaubensvorstellungen und Schamanismus weiterhin großer Beliebtheit.

Während der Zeit des Khazar Kaganate bekannten sich die Bewohner dieses Reiches zum Judentum, das die heutigen Karäer, Fragmente dieser mächtigen türkischen Macht, weiterhin als die einzig wahre Religion betrachten.
Wortschatz
Zusammen mit der Weltzivilisation entwickelten sich auch türkische Sprachen, die den Wortschatz benachbarter Völker aufnahmen und sie großzügig mit eigenen Worten ausstatteten. Es ist schwierig, die Anzahl der entlehnten türkischen Wörter in ostslawischen Sprachen zu zählen. Angefangen hat alles mit den Bulgaren, von denen die Worte „Tropf“ entlehnt wurden, aus denen „kapishche“, „suvart“ entstand, umgewandelt in „Serum“. Später begann man, anstelle von „Molke“ den üblichen türkischen „Joghurt“ zu verwenden.

Besonders lebhaft wurde der Wortschatzaustausch während der Goldenen Horde und im Spätmittelalter, während des aktiven Handels mit türkischen Ländern. Eine große Anzahl neuer Wörter kam in Gebrauch: Esel, Mütze, Schärpe, Rosine, Schuh, Truhe und andere. Später wurden nur noch die Namen bestimmter Begriffe entlehnt, zum Beispiel Schneeleopard, Ulme, Dung, Kishlak.
 Türkische Sprachgruppe: Völker, Klassifikation, Verbreitung und interessante Fakten Türkische Sprachfamilie der Völker
Türkische Sprachgruppe: Völker, Klassifikation, Verbreitung und interessante Fakten Türkische Sprachfamilie der Völker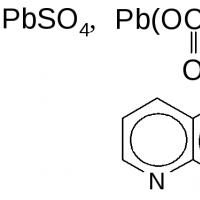 Acetylen ist das Gas mit der höchsten Flammentemperatur!
Acetylen ist das Gas mit der höchsten Flammentemperatur!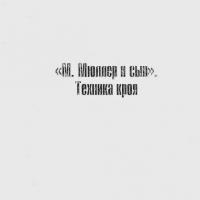 Kleidungsdesign-(Schnitt-)System „M“
Kleidungsdesign-(Schnitt-)System „M“ Welche Möglichkeiten gibt es, wild lebende Tiere und Pflanzen zu schützen?
Welche Möglichkeiten gibt es, wild lebende Tiere und Pflanzen zu schützen?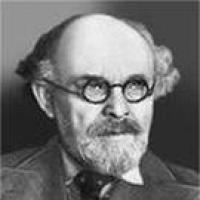 Literaturtest zum Thema „Pantry of the Sun“ (M
Literaturtest zum Thema „Pantry of the Sun“ (M Kräuter: Kräuterarten, kulinarische Verwendung und Geschmackskombinationen
Kräuter: Kräuterarten, kulinarische Verwendung und Geschmackskombinationen Präsens (Einfach, Kontinuierlich, Perfekt, Perfekt Kontinuierlich)
Präsens (Einfach, Kontinuierlich, Perfekt, Perfekt Kontinuierlich)